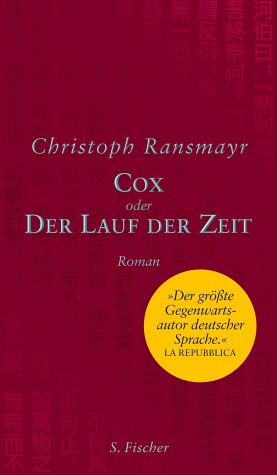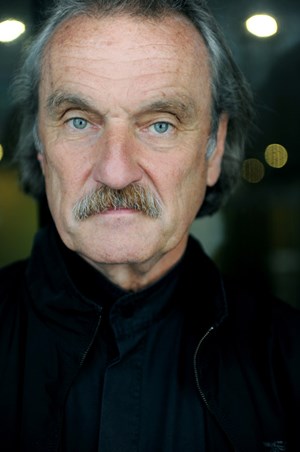Das Wort vermag den, der es schreibt oder liest nicht nur über Meere und Gebirge, sondern über die Zeit selbst zu erheben – bleibt es doch zumindest lesbar, wenn er selbst bereits seit Jahren oder Jahrtausenden wieder verstummt ist
Im Wort Ozean erheben sich keine Stürme, stampfen keine Schiffe und wird auch kein Mensch je in Seenot geraten. Im Wort Wüste ist noch keiner verdurstet und im Wort Abgrund kein Unglücklicher jemals zu Tode gestürzt. Und dennoch beschwören diese und alle Worte und Sätze, in denen greifbare Wirklichkeit in Sprache verwandelt wird, in unserem Denken und Fühlen etwas, das an die Glücksmöglichkeiten und Katastrophen der realen Welt rührt und in uns Bilder von einer Deutlichkeit aufsteigen lässt, als stünden wir tatsächlich vor der anrollenden Brandung, vor einem geliebten Menschen oder dem Abgrund. Und für den Zauber dieser Verwandlung bedarf es nicht mehr als jener Kraft, die jeder Mensch in sich selbst trägt und ihm ermöglicht, alles, was sich überhaupt sagen lässt oder noch unausgesprochen auf seine Formulierung wartet, zur Sprache zu bringen.
Dass ein Mensch in Worten weder ertrinken noch durch die unzähligen Arten der Grausamkeit zugrunde gehen kann, schenkt dem Zauber der Verwandlung von etwas in Sprache zunächst eine seltsame Friedlichkeit, so, als ob Bücher und jede Schrift uns einen besseren Schutz bieten könnten als jede Waffe oder Panzerung. Wie von einem Kokon umgeben, treten wir aus dem Inneren von Märchen oder anderen, frühesten Erzählungen unserer Kindheit hinaus in die donnernde, anrollende Welt, um dort zu jagen, zu lieben, Städte zu bauen – oder Kriege zu führen. Denn Worte, auch das erfahren wir bereits im frühesten Umgang mit Sprache, Worte sind wie die Menschen, die sie aussprechen, schreiben oder lesen, nicht nur gut. Sie folgen manchmal auch der Pervertierung Luzifers, des Lichtbringers, der aus dem Paradies in die Finsternis stürzte und im Fallen vom Engel zum Satan wurde.
Wer sein Leben der oft begeisternden, oft erschöpfenden Arbeit an der Sprache verschrieben hat, der wird am Anfang aber lange schweigen, lange bloß betrachten und stillhalten müssen, um den Stimmen der Menschen, denen der Tiere oder dem bloßen Geräusch des Windes im Gestrüpp der Antennen zu lauschen. Und er wird, lange bevor er nach eigenen Wortschöpfungen und Sätzen sucht, Fragen stellen und Fragen beantworten, Fragen etwa wie jene, wie kalt und unbewegt die Meerestiefe vier und fünftausend Meter unter dem Kiel eines Frachters ist, der auf einer transatlantischen Route im Sturm liegt. Fragen nach den Namen der Leuchtfische, die durch das submarine Dunkel schweben. Fragen, was das denn ist – Dunkelheit? Und was Trauer, Hoffnung oder ein Abschied? Wie ist es, wenn einer im Lärm der Welt taub wird? Was macht einen Menschen blind? Und was gewalttätig …?
Wort, Klang, Bild
Wenn einer erzählen will, muss er solche und ähnliche und unzählige andere Fragen zu beantworten versuchen und muss doch nach jeder Antwort immer neue Fragen an sich und die Welt richten, bis er sich endlich erheben und etwas so Einfaches und Ungeheuerliches wie „Es war … Es war einmal“ sagen kann. Aber selbst wenn er auf jede Nachforschung verzichtet und sagt: Mir genügt das Meinige, ich spreche nur von mir, ich spreche nur vom Allervertrautesten, nur von dem, was ich allein und am besten weiß – selbst dann erscheint einem Erzähler die Welt noch einmal anders und neu -, muss er sich doch auch der einfachsten Dinge seiner Geschichte erst vergewissern. Wovon immer er spricht – in seiner Geschichte muss ein Erzähler alle Welt noch einmal und immer wieder erschaffen und darf dabei nicht mehr voraussetzen als die Aufmerksamkeit seiner Zuhörer, seiner Leser, nichts als die Stille, in der er endlich zu sprechen, zu erzählen, zu schreiben beginnt.
Erzählen besteht immer aus einer Stimme und einem Ohr, aus einem Bild und einem Auge, das alle Wirklichkeit ins Bewusstsein, in Herz und Gedächtnis überführt. Dabei ruht jede Silbe eingebettet in die Stille des ungeheuren, uns umgebenden Raumes, in das Unsagbare, und jedes Bild eingebettet in die Finsternis. Gerade dadurch erscheinen Wort, Klang, Bild vielleicht ja als die größten Kostbarkeiten der menschlichen Existenz. Schließlich vermag das Wort den, der es schreibt oder liest, nicht nur über Meere und Gebirge, sondern über die Zeit selbst zu erheben – bleibt es doch zumindest lesbar, wenn er selbst bereits seit Jahren oder Jahrtausenden wieder verstummt ist.
Wenn uns in diesen Tagen blindwütige, religiös verseuchte Berserker den Schluss aufzwingen, die Abwehr ihrer Mordgier und Zerstörungswut wäre am ehesten durch noch mehr Gewalt, noch mehr Panzerung und Überwachung zu erwarten, werden Erinnerungen an die Wurzeln eines Hasses wach, von denen manche tief in unsere eigene, europäische, Geschichte hinabreichen. Jahrhundertelang hat Europa nahe und fernste Kulturen überrannt, ausgebeutet oder zerstört und damit den eigenen Wohlstand begründet. Spanische und portugiesische und niederländische und englische und französische und deutsche und belgische und italienische und immer weitere und noch mehr Kolonialherren haben im Rest der Welt willkürlich Grenzen durch uralte Einheiten gezogen, haben Landesbewohner vertrieben, versklavt, verstümmelt oder erschlagen und mit Handelsstationen und Minen immer auch Massengräber eröffnet.
Wenn sich nun aus verwüsteten und zerrissenen Landstrichen und entsprechend verwüsteten Regionen des Bewusstseins Killer auf den Weg machen, um den Hinrichtungsbefehl eines Predigers zu befolgen oder einen barbarischen Missionsauftrag mit automatischen Waffen und Sprengstoffgürteln zu erfüllen, ist es, als ob sie sich an europäischen Eroberern vergangener Jahrhunderte ein Beispiel nehmen wollten, an Helden der Kolonialgeschichte, die ganze Kontinente terrorisierten, um ihre Bewohner als Lieferanten des europäischen Reichtums gefügig zu machen oder zu vernichten. Unzählige, immer noch offene Rechnungen, stehen so in Bilanzen, die nicht Jahre und Jahrzehnte, sondern Jahrhunderte überspannen. Allein die zehn Millionen Toten, um nur eines, ein einziges Beispiel zu nennen, allein die zehn Millionen Toten, die etwa ein europäischer Massenmörder wie der belgische König Leopold II. im Kongo hinterlassen hat, könnten unter dem Einfluss entsprechender Prediger wohl drei und vier Generationen von Rächern auf den Weg nach Europa bringen.
Aber gegen Menschen, die in ihrer rasenden Wut oder bloßen Dummheit den eigenen Körper in eine Waffe verwandeln und selbst um den Preis des eigenen Lebens nichts mehr wollen als töten, werden auch in Zukunft die meis- ten Verteidigungstechniken wirkungslos bleiben. Natürlich werden die Angegriffenen sich in Notwehr aller ihrer Mittel bedienen, aber die einzige dauerhafte, wenn auch niederschmetternd langsame und deshalb oft zu spät kommende Hilfe kann aus keiner anderen Quelle gespeist werden als jener der Sprache, des Wortes. Nicht die Sensen und Dreschflegel der Bauernkriege haben am Ende die feudale Grausamkeit des Mittelalters zerschlagen, sondern die Gedanken der Aufklärung; das Wort.
Nur eine Gesellschaft, die selbst unter der Bedrohung durch eine Armee von fundamentalistisch religiösen Massenmördern nicht bloß ihre Waffen, sondern auch das Wort wieder einsetzt in seine Dogmen sprengende Kraft, wird sich am Ende – vielleicht – wenn nicht als unbesiegbar, so doch als die stärkere erweisen. Und der Erzähler und Literat, der dieser Gesellschaft beisteht, indem er als Romancier, Essayist, Dramatiker oder in den Strophen seiner Poesie zumindest eine Vorstellung vom wahren Glück und Leiden des Einzelnen ermöglicht, wird zwar niemals ein Prophet sein, aber zumindest ein Helfer. (Christoph Ransmayr, Album, 5.12.2015)